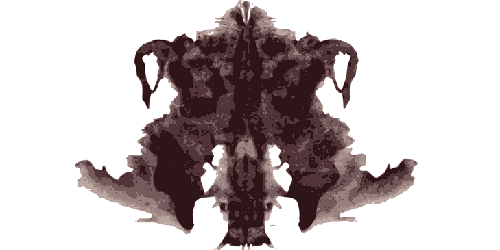Mindblown: a blog about philosophy.
-

FREITAG: Der Wandel wird handgreiflich
Ob es mit dem Herbst zu tun hat, an dem man erntet, oder einfach am Lauf der Dinge – ich weiß nicht, warum sich gerade jetzt der Wandel zu manifestieren […]
-

FREITAG: Die Ineffizienz von Interpretationen
Manche Dinge ändern sich einfach nicht, auch nicht mit zunehmendem Alter, und schon gar nicht bei Frauen. Denn irgendwo haben wir das Interpretationsgen versteckt, das sich weder abschalten noch zertrümmern […]
-

FREITAG: Die Lücke im Wandel der Zeit
Zeit meines Lebens habe ich mich als einigermaßen konstanten Menschen empfunden. Doch je mehr ich auf meinen Körper achten muss, umso mehr zweifle ich daran – und tue mich schwer, […]
-

FREITAG: Die Tapetentüre
Es gäbe diese Woche ja einiges, worüber ich berichten könnte. Allerdings versuche ich ja immer, hinter allem, was mir passiert, den tieferen Sinn herauszubuddeln. Es gibt ihn nicht bei allem, […]
-

FREITAG: Hoffnung genießen
„Hoffen bedeutet, nichts machen. Man kann hoffen, oder man kann tun.“ Das las ich am Wochenende in einer Zeitung. Und obwohl noch eine ganze Seite zu diesem Inhalt geschrieben stand, […]
-

FREITAG: Megatrend Achtsamkeit
Mein Ältester und ich sind unfreiwillige Trendsetter, haben wir gestern festgestellt. Denn bei einem Vortrag über Achtsamkeit kam zutage, dass das das einzige Rezept gegen die Vibes der heutigen Zeit […]
-

FREITAG: Der Intuition folgen
Langsam gruselt es mich vor mir selber. Doch nur genau in dem Moment, wo ich mich vergleiche – mit mir selbst vor einigen Monaten. Dann siegt die Neugierde darüber, was […]
-

FREITAG: Es herbstelt
Ach, ich mag den Herbst – auch wenn mein Kühlschrank vor Trauben, Zwetschgen und Äpfeln überquillt. Ja, Erntezeit ist eine fruchtbare Zeit, und langsam beginnt auch das vorsichtige Ernten aus […]
-

FREITAG: Reden statt anklagen
Man kann es mit allem übertreiben, finde ich. Vor allem Drama Lamas greifen gerne zu diesem aufmerksamkeitsverschaffenden Trick. Doch die meisten von ihnen bringen damit niemanden in den Knast – […]
-

FREITAG: Die Zeit ist reif für Griechenland
Der Vorteil von Auszeiten ist ja unter anderem, dass man lernt. Und das muss gar nichts Großartiges sein, wenn auch etwas Großartiges daraus resultieren kann. Während meines Urlaubs ist etwas […]
Hast du irgendwelche Buchempfehlungen?